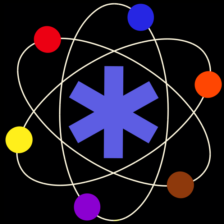Was posttraumatischer Streß, PTS, sowie die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, sind, welche Ursachen sie haben und was therapiert werden muß, lesen Sie hier:
1. Posttraumatischer Streß und seine Auslöser
Von den vielen Auslösern von posttraumatischem Streß wollen wir uns zunächst zwei herausgreifen, die uns bei komplexen und belastenden Tätigkeiten begegnen können.
1.1. Zwischenfälle an Hochrisikoarbeitsplätzen
Menschen an Hochrisikoarbeitsplätzen sehen sich einer hohen Verantwortung gegenüber, weil Fehler weitreichende Konsequenzen haben können. Doch auch bei Bedrohungen müssen diese Menschen schnell und gekonnt reagieren, um Schäden abzuwenden. Wir können uns daher vorstellen, daß posttraumatischer Streß die Folge von Fehlern oder Bedrohungen sein kann.
1.2. Posttraumatischer Streß bei Hilfsorganisationen
Mitarbeitende bei Hilfsorganisationen sind ebenfalls an Hochrisikoarbeitsplätzen beschäftigt. Denn auch bei ihren Tätigkeiten können Fehler erhebliche Folgen haben, zum Beispiel für Patientinnen und Patienten. Hinzu kommen besonders belastende Einsätze, bei welchen erhebliches Leid mitangesehen werden muß. Es ist nicht immer einfach, sich davon professionell abzugrenzen.
1.3. Posttraumatischer Streß als häufige und normale Reaktion
Doch auch alltäglichere Ereignisse, wie Autounfälle, können zu posttraumatischem Streß führen. Also Begebenheiten, die uns zunächst erschrecken, bevor wir sie verarbeiten. Posttraumatischer Streß ist dabei normal und häufig, die meisten Menschen erleben eine solche Episode irgendwann, ohne daß sie diese als PTS definieren. Denn dazu muß man die Symptome erkennen und einordnen können.
Warum und wie die Symptome entstehen, welchen Sinn sie haben und wie es dann weitergeht, sehen wir uns nachfolgend an.
2. Symptome und Verlauf von PTS
2.1. So fühlt sich posttraumatischer Streß für uns an
Die akute Reaktion unseres Körpers
Die meisten von uns erinnern sich an unangenehme Situationen, die uns mit Schrecken, Herzklopfen, schweißnassen und zitternden Händen, trockenem Mund und gefühlt leerem Gehirn zurückgelassen haben. Es sind die Symptome der entwicklungsgeschichtlich uralten Flucht-Starre-oder-Kampf-Reaktion.
Diese Reaktion bereitet uns körperlich darauf vor, in einer Gefahr blitzschnell zu reagieren, um uns daraus zu befreien. Ausgelöst wird sie durch die Ausschüttung von Botenstoffen im Körper, die denjenigen Teil unseres Nervensystems aktivieren, der uns in die Flucht- und Kampfbereitschaft versetzt. Deshalb steigen Herzfrequenz, Atemfrequenz- und tiefe, die Muskeln werden angespannt, während z. B. die im Moment nebensächliche Verdauung unterbrochen wird.
Die nächsten Tage
Es ist normal, daß wir diese Reaktion unseres Körpers für ein paar Tage erneut erleben, wenn wir die Situation im Geiste wieder vor uns sehen oder durch äußere Reize, wie Gerüche, Orte oder bestimme Wortmeldungen daran erinnert werden.
Möglicherweise erscheint die durchlebte Situation in Träumen. Es kann passieren, daß wir Angst haben, erneut die Handlung auszuführen, während welcher das Ereignis eingetreten war. Die Spannbreite reicht von Unfällen im Freizeit- oder Leistungssport, über berufliche Unfälle, dem Miterleben von plötzlichem schwerem Leid, bis hin zum Hineingeraten in eine Gewalttat.
Was wir aus unserer Erfahrung mitnehmen
Ein möglicher positiver Sinn dieses Erlebens könnte aus evolutionsbiologischer Sicht sein, daß wir uns die Gefahrensituation gut einprägen. So gewappnet werden wir uns wahrscheinlich zukünftig bei ähnlichen Gegebenheiten vorsichtig und vorausschauend verhalten, um unbeschadet daraus hervorzugehen.
2.2. Unkomplizierter posttraumatischer Streß muß nicht therapiert werden
Wie wir oben gesehen haben, ist posttraumatischer Streß eine normale Reaktion, die uns auch dabei hilft, ein Ereignis verarbeiten. Wie gut uns das gelingt, hängt von vielen Faktoren ab, darunter auch, wie schwer und wie langanhaltend das traumatisierende Geschehen für uns war. Hilfreich sind eine stabile Ausgangssituation, primär gutes persönliches Befinden und ein unterstützendes Umfeld, aber auch entspannende Interessen wie Yoga, Musizieren oder Sport in der Natur.
Posttraumatischer Streß vergeht üblicherweise nach ein paar Tagen von selbst und bedarf daher keiner Therapie. Wenn PTS so unkompliziert verläuft, ist er somit keine Diagnose und hat auch keinen Krankheitswert.
2.3. Wann man Hilfe beanspruchen sollte
In manchen Fällen können die Symptome jedoch den Alltag erheblich beeinflussen. Zum Beispiel denken die Betroffenen dauernd an das Ereignis, meiden Menschen oder Orte. Zudem konsumieren manche vermehrt Alkohol oder Beruhigungsmittel sowie eventuell weitere Substanzen, um die Symptome einzdämmen.
Bei solchen Verhaltensweisen ist es ratsam, sich nicht weiter mit dem eigentlichen Problem dahinter zu verstecken, sondern psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den posttraumatischen Streß zu bearbeiten. Damit wird vor allem auch sein Fortschreiten in die posttraumatische Belastungsstörung verhindert.
3. Wenn sich posttraumatischer Streß zu einer PTBS entwickelt
3.1. Der posttraumatische Streß vergeht nicht
Wenn posttraumatischer Streß nach einem schwerwiegenden Ereignis, wie dem Erleben von Todesgefahr für sich selbst oder einen nahestehenden Menschen, nicht aufhört und das Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigt, ist er in eine posttraumatische Belastungsstörung übergegangen.
Warum manche Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, während andere davon verschont bleiben, ist nicht abschließend geklärt. Insgesamt ist die PTBS auf die Gesamtbevölkerung gesehen selten. Sie kann sich auch ohne vorherigen posttraumatischen Streß manifestieren.
3.2. Die posttraumatische Belastungsstörung
Im Gegensatz zum PTS liegt bei der posttraumatischen Belastungsstörung eine klinisch zu diagnostizierende Erkrankung vor, und die Betroffenen benötigen eine Behandlung.
Viele Symptome ähneln jenen bei PTS, doch sie unterscheiden sich in ihrer Intensität und Dauer. So halten die Symptome über mehr als einen Monat an und beeinträchtigen das Alltagsleben erheblich.
Die Betroffenen durchleben die initiale traumatisierende Situation in Alpträumen und Rückblenden (Flashbacks) immer wieder. Sie meiden Menschen oder Plätze, die sie an das Trauma erinnern. Das Gemüt ist herabgestimmt, die Betroffenen erleben vor allem negative Gefühle, wie Angst, permanente Anspannung und Nervosität. Auch der Ausbruch in Tränen, sobald sie an das Ereignis erinnert werden, ist keine Seltenheit.
Verhaltensweisen, die auf eine PTBS hinweisen sind Alkohol- und Substanzkonsum, die die Symptome erträglich machen sollen sowie rücksichtsloses Benehmen, wie aggressives Fahrverhalten. Aber auch das Meiden von Menschenansammlungen, vor allem in geschlossenen Räumen und der Rückzug aus familiären oder freundschaftlichen Bindungen gehören dazu.
4. Die Therapie und Prognose einer PTBS
4.1. Wer hilft überhaupt?
Da es sich bei der PTBS um ein Leiden der Psyche handelt, sind in der Traumatherapie erfahrene Psychotherapeutinnen und -therapeuten die richtigen Ansprechpartner. Zunächst wird durch ein vorsichtig geführtes Erstgespräch das Trauma eruiert. Dabei kann auch ein international standardisierter Fragebogen wie die Posttraumatic Diagnostic Scale, PDS, eingesetzt werden.
4.2. Traumatherapie und Medikamente bei Bedarf
Am wichtigsten bei der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung ist die Traumatherapie, in der sich Betroffene zusammen mit dem Therapeuten mit ihrem Trauma auseinandersetzen, um es zu bearbeiten. Häufig wird die cognitive Verhaltenstherapie eingesetzt, um Gedanken und Gefühle, die die Betroffenen mit ihrem belastenden Ereignis in Verbindung bringen, neu zu gewichten.
Medikamente werden unterstützend eingesetzt, vor allem moderne Antidepressiva.
4.3. Viele Menschen erholen sich von ihrer PTBS
Je nach Art des Auslösers, Dauer und Schwere des Erlebten gestaltet sich die Prognose unterschiedlich. Viele Menschen erholen sich nach mindestens 12-15 Wochen Therapie, manche brauchen über Jahre Hilfe, um in Ihrem Alltag zurechtzukommen. Dabei spielen etliche Faktoren, wie die eigenen Resourcen, die persönliche Vorgeschichte, aber auch die Notwendigkeit, über lange Zeiträume Prozesse nach einer Gewalttat oder einem Unfall führen zu müssen, eine Rolle.
5. Posttraumatischer Streß, PTBS und Offenheit
5.1. Schon posttraumatischer Streß darf besprochen werden
Jeder reagiert anders auf ein erschreckendes Erlebnis. Daher ist auch der Redebedarf bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Wichtig ist, daß wir erkennen, daß posttraumatischer Streß nicht peinlich ist, und wir darüber mit Vertrauten sprechen sollten, wenn uns danach ist.
5.2. Offener Umgang mit einer PTBS
Der offene Umgang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kostet größere Überwindung, da hier eine therapiewürdige Diagnose vorliegt, die die Betroffenen selbst, aber auch ihr Umfeld, vielleicht als Schwäche auffassen. Noch dazu kann dies für leistungsbezogene Menschen in einer leistungsorientierten Umgebung erschwert sein.
5.3. Sachbezogene Offenheit ist mutig und eine Chance
Offenes und sachliches Schildern einer Begebenheit mit dem Ziel, darüber aufzuklären, ist keine Schwäche, sondern erfordert enormen Mut.
Nur wenn Betroffene mit uns teilen, was sie erlebt haben oder noch erleben müssen, aber auch, wie sie ihre PTBS bewältigt und ihr Leben wieder in die Hand genommen haben, können wir dieses Krankheitsbild kennen- und verstehen lernen. Der Mut der Betroffenen und ihre Tatkraft sind daher von großer Bedeutung für uns.
6. In meinem nächsten Blogartikel lesen Sie:
Eine bekannte Persönlichkeit, die Großes vollbracht hat, hat nicht nur ihre PTBS erfolgreich besiegt, sondern leistet auch bemerkenswerte Aufklärungsarbeit über posttraumatischen Streß und PTBS. Wir werden uns im August mit ihr befassen und lernen, wie wir in unserem Alltag durch Hinsehen, Erkennen und Handeln bei uns selbst und anderen in Bezug auf diese Themen viel bewegen können.
Autorin: Eva-Maria Schottdorf
Datum: 31. Juli 2022
Auf meiner Blogseite habe ich weitere Blogartikel für Sie verlinkt.